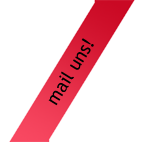Seit 30 Jahren verhindert der bundesdeutsche Staat eine lückenlose Aufklärung der letzten Lebensstunden der RAF-Mitglieder im Stammheimer Hochsicherheitstrakt. Wer die offizielle Selbstmordthese in Zweifel zieht, wird diffamiert
Von Ron Augustin
- Quelle: jungeWelt vom 10.09.2007
- * Schon seit Wochen stimmen die bundesdeutschen Medien die Öffentlichkeit auf den »deutschen Herbst« 1977 ein. Was den Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ingrid Schubert, Jan-Carl Raspe und Ulrike Meinhof betrifft, übernehmen sie unkritisch die These vom Selbstmord der Gefangenen. Dabei gibt es bis heute viel Ungeklärtes. Ron Augustin meldet deshalb seine Zweifel an der staatsoffiziellen Version an. Er war ab 1971 Mitglied der RAF. Zwischen 1973 und 1980 saß er wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Urkundenfälschung fast ununterbrochen in Einzelhaft. (jW)
- Am Morgen des 18. Oktober 1977 wurden im Stammheimer Hochsicherheitstrakt drei Gefangene aus der RAF tot oder sterbend und eine schwerverletzt aufgefunden. Obwohl die gerichtsmedizinischen Untersuchungen »aus polizeilichen Gründen« erst am Nachmittag, um 16 Uhr, anfangen würden, wurde von der baden-württembergischen Landesregierung schon um neun Uhr früh die Nachricht verbreitet, daß die Gefangenen sich selbst das Leben genommen hätten. Um 14 Uhr wurde die versammelte Presse vom Sprecher der Bundesregierung, Klaus Bölling, auf »Selbstmord« eingestimmt, während die SPD-Bundestagsfraktion in einer Sondersitzung von Willy Brandt gemahnt wurde, »kleinkarierten Streit« über die Umstände »beiseite zu schieben«.
- Weil ich damals mit etwa 70 anderen Gefangenen dem Vakuum der »Kontaktsperre« unterlag, habe ich vom Tod der Gefangenen erst am nächsten Tag etwas erfahren, als meine Zelle in der Justizvollzugsanstalt Hannover auf Weisung des Bundeskriminalamtes durchsucht und mir der »Sachverhalt« dargestellt wurde. Danach hätten Andreas Baader und Jan Raspe sich mit Pistolen umgebracht, hätte Gudrun Ensslin sich mit einem Stromkabel erhängt und Irmgard Möller sich mit mehreren Messerstichen verletzt.
- Die Nachricht hat mich erst mal umgehauen– wieder waren welche von uns tot, und dabei die, die für mich in meinem Leben am wichtigsten waren. Ich war verzweifelt, konnte mir aber nicht zuviel anmerken lassen, weil im selben Moment der Terror mit der permanenten Überwachung anfing und somit der Kampf dagegen. Monatelang wurde ich, wie die anderen Gefangenen aus der RAF, 24 Stunden am Tag beobachtet. Nachts blieb das Licht in der Zelle an, jede Viertelstunde wurde durch die Klappe geguckt, fast jeden Tag wurde die Zelle umgewühlt. Formal unter dem Vorwand, uns vor weiteren »Selbstmorden« zu schützen, unter der Hand aber mündlich vermittelt als der Versuch, welche von uns mürbe zu machen und zu öffentlicher Reue zu bewegen.
- Die »Kontaktsperre« wurde bei mir erst am 31. Oktober aufgehoben. Damit konnte ich wieder Besuch von Angehörigen und Rechtsanwälten bekommen, war aber weiterhin von Kontakten zu Mitgefangenen ausgeschlossen. Ausnahmslos alle Anträge von Leuten die mich besuchen wollten, z. B. Wolfgang Grams, wurden abgeschmettert, ihre Briefe mit den abstrusesten Begründungen beschlagnahmt. Privatpost, Verteidigerpost, Zeitungen, Bücher und sonstige Nachrichtenquellen unterlagen einer verschärften Zensur. So wurde der Bericht des baden-württembergischen Landtages zur Stammheimer Todesnacht nicht ausgehändigt, weil »Sicherheit und Ordnung gefährdet werden« könnten. Es hat also Jahre gedauert, bis ich an die– dürftigen – Informationen zur Todesnacht rankam und mit anderen darüber sprechen konnte.
- Heute, 30 Jahre nach dato, kann ich den Selbstmordversionen nach wie vor keinen Glauben schenken. Nicht, weil ich nie Zweifel gehabt hätte. Nicht, daß ich die unterschiedlichen Spekulationen nie an mich herangelassen hätte. Auch nicht, daß ich nie selbst der Verzweiflung nahe gewesen wäre, unter dem Druck der maßlosen Hetze, der ich wie die anderen Gefangenen von Anfang an ausgesetzt war: nie mit Fakten unterbreitet, sondern durchgehend aufgrund von gleichgeschalteten Sprachregelungen, Unterstellungen, Verleumdungen, Verdrehungen, Fälschungen. Nein, was mich bei jeder »zweifelsfreien Erkenntnis« aufs neue stutzig gemacht hat, war, daß ich sie – die Toten – doch besser gekannt hatte, als was da alles aufgetischt wurde.
- Baaders und Raspes Tod
- Zunächst einmal gibt es die bekannten Fakten, von denen die meisten inzwischen von Rechtsanwalt Weidenhammer in einem trefflichen Buch zusammengetragen worden sind.1 Zur Erinnerung fasse ich sie kurz zusammen.
- Den kriminaltechnischen Ermittlungen zufolge hätte Andreas Baader sich mit einer 18 Zentimeter langen Pistole erschossen, durch einen aufgesetzten Schuß genau in der Mitte des Nackens, drei Zentimeter über dem Haaransatz, mit einer Ausschußöffnung deutlich oberhalb der Stirn-Haar-Grenze. Nach einem BKA-Gutachten, das sich auf eine Röntgenfluoreszenzanalyse stützt, konnte der Schuß aber nur aus einer Entfernung von 30 bis 40 Zentimetern (zwischen der Pistolenmündung und der Einschußstelle) abgegeben worden sein. Aus der Lage der Pistole, der Patronenhülsen und aus Schmauchspuren sowie Blutspritzern an der rechten Hand wurde geschlußfolgert, daß die Waffe mit dem Griff nach unten gehalten und mit der rechten Hand abgefeuert worden sei. In dem Wissen, daß Andreas Linkshänder war, wurde dann eine Theorie verbreitet, nach der er sich die Waffe mit dem Griff nach oben aufgesetzt haben müsse, mit der rechten Hand um den Pistolenlauf herum. Andererseits hätten Laboruntersuchungen beider Hände mit Natriumrhodizonat »keine als Schußspuren anzusehenden Anhaftungen« ergeben. Die drei in der Zelle abgefeuerten Geschosse und ihre Hülsen wurden nicht mit der aufgefundenen Waffe verglichen. So wurde weder die Tatwaffe eindeutig festgestellt noch die Reihenfolge der drei Schüsse. Eine wichtige, »tatspezifische« Probe aus Blut- und Geweberesten von der Abprallstelle (»Spur Nr. 6«) soll beim Obduzenten Professor Rauschke »verlorengegangen« sein.
- Auch bei Jan Raspe konnten keine Schmauchspuren an den Händen festgestellt werden. An der bei ihm gefundenen Pistole gab es keine Spur von Blut, obwohl er offensichtlich an einem Nahschuß in die rechte Schläfe starb. Nach den Aussagen der Beamten, die ihn am Morgen in der Zelle sterbend auffanden, hätte die Pistole noch in seiner Hand gelegen. Bei einer Pistole in der Hand muß nach kriminaltechnischen Erkenntnissen grundsätzlich auf Verschleierung einer Fremdtötung geschlossen werden, weil die Waffe ansonsten durch den Rückstoß aus der Hand geschleudert worden wäre. In den Ermittlungsakten und Zeugenbefragungen sind darüber dann die unterschiedlichsten Überlegungen angestellt worden, die nur als Vertuschungsversuche gedeutet werden können. Hieß es im Bericht des baden-württembergischen Landtages noch: »Die genaue Lage der Pistole ist ungeklärt«, so wurde daraus in der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft: »Neben seiner rechten Hand lag eine Pistole.« Ein anderer Versuch, Fremdeinwirkung auszuschließen, wurde mit der Behauptung unternommen, daß es rechts von Jan keinen Platz für eine andere Person gegeben hätte – eine Behauptung, die schon in sich einfach widerlegt werden konnte.
- An den Pistolen konnten keine Fingerabdrücke gefunden werden. Obwohl sie keine Spuren von Blut aufwiesen, erklärte die Staatsanwaltschaft zuerst, »daß die Waffen so voll Blut waren, daß Spuren nicht mehr festgestellt werden konnten«. In der Folge war das Blut dann noch »eingedickt«, bevor die Waffen plötzlich »abgewischt« und schließlich von einem »Ölfilm« bedeckt gewesen seien. In den polizeilichen Kommentaren hieß es lapidar: »Wenn die Waffen vor der Tat mit einem Tuch abgewischt worden wären, dann hätten vom einmaligen Benutzen keine verwertbaren Spuren zurückbleiben können« und »Fingerabdrücke würden sich auf eingefetteten Waffen nicht halten.«2
- Zweifelhafte Selbstmordthese
- Gudrun Ensslin wurde erhängt an einem Stromkabel am Zellenfenster aufgefunden. Beim Versuch, sie abzuhängen, riß das Kabel sofort. Weshalb es nicht schon während des Todessturzes abgerissen war, wurde nicht hinterfragt. Am Hals wurde eine doppelte Hängespur auf beiden Seiten bis hinter den Kopf mit zusätzlicher Kammblutung festgestellt. Ein Histamintest, mit dem in der Regel festgestellt werden kann, ob die Aufhängung vor oder nach dem Tod stattgefunden hat, wurde zwar vorbereitet, aber dann doch nicht durchgeführt. Eine daktyloskopische Spurensicherung wurde nicht veranlaßt, nicht einmal am Kabel. Der Stuhl, der zum Springen benutzt sein soll, wurde ebensowenig auf Spuren untersucht wie z.B. ihre Fingernägel. Spuren von Verletzungen am Rücken, am rechten Mundwinkel, an der Nase, an der Kopfhaut und an der linken Leiste wurden festgestellt, aber nicht näher untersucht. Die Tatsache, daß Briefe und andere schriftliche Unterlagen aus der Zelle entfernt worden waren, wurde anfangs als »Beschlagnahme« bestätigt, dann bestritten, dann später von Generalbundesanwalt Kurt Rebmann teilweise zugegeben. Soweit sie heute noch existieren, sind sie nach wie vor unter Verschluß. Bei Andreas und Gudrun ist die Feststellung des Todeszeitpunkts dadurch vereitelt worden, daß den Gerichtsmedizinern acht Stunden lang der Zutritt zu den Zellen verweigert wurde.
- Irmgard Möller überlebte die Todesnacht mit Schnittverletzungen an den Handgelenken und vier Messerstichen im Herzbereich. Den Ermittlungen zufolge hätte sie sich gleichsam im Harakiri mit einem kleinen, stumpfen, zum Anstaltsbesteck gehörenden Messer aus Chrom umzubringen versucht: mit großer Wucht, weil die fünfte Rippe eingekerbt und einer der vier Stiche sieben Zentimeter tief bis an den Herzbeutel eingedrungen war. In der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft blieben davon nur noch zwei bis vier Zentimeter übrig. An dem blutverschmierten Messer konnten keine Fingerabdrücke festgestellt werden. Irmgards Versuche, ihre Röntgenbilder zu bekommen, schlugen fehl. Der Pullover, den sie trug, war nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus so zerrissen, daß Beschädigungen durch Messerstiche angeblich nicht mehr festgestellt werden konnten. Im polizeilichen Ermittlungsbericht heißt es: »Der Pulli ist so zerschnitten, daß seine ursprüngliche Form nicht mehr brauchbar rekonstruiert werden kann.« Und: »Stichbeschädigungen sind wegen des schlechten Zustandes nicht mit der gebotenen Sicherheit auszumachen.« In der Einstellungsbegründung der Staatsanwaltschaft liest sich das dann so: »Der von Irmgard Möller als einzige Bekleidung ihres Oberkörpers getragene Pullover war zwar auf der Vorderseite von Blut durchtränkt, jedoch nicht beschädigt; ein mit Tötungsabsicht Angreifender hätte auf die Kleidung seines Opfers erfahrungsgemäß keine Rücksicht genommen.« Irmgard hat immer von sich gewiesen, sich die Verletzungen selbst zugefügt zu haben oder daß es Absprachen zum kollektiven Selbstmord gegeben hätte.3
- Keine vier Wochen später, am 12.11.1977, lag Ingrid Schubert tot in einer abgelegenen Zelle im Gefängnis München-Stadelheim. Sie befand sich seit Mitte August 1977 in diesem Knast und war wenige Stunden vor ihrem Tod aus einer anderen Zelle verlegt worden, nachdem am Tag zuvor bekanntgemacht worden war, daß in der Zelle, in der sie bis Mitte August in Stammheim gewesen war, ein Versteck mit Sprengstoff gefunden worden sei. Ingrid soll sich mit einer Schleife, die aus drei Bettlakenstreifen geflochten war, erhängt haben. Die Bettlakenstreifen bestanden aus fester Baumwolle von etwa acht mal 240 Zentimeter. Die Reißmuster der einzelnen Streifen stimmten nicht miteinander überein. Das heißt, daß sie entweder nicht vom restlichen Bettlaken in der Zelle stammten, oder daß es zwischen ihnen zusätzliche Stücke gab, die aber spurlos verschwunden sind. Hätte Ingrid das Bettlaken selbst zerrissen, so hätten sich irgendwo in der Zelle Textilfaserspuren finden müssen. Den kriminaltechnischen Ermittlungen zufolge aber »konnten an keinem der vorliegenden Kleidungsstücke Baumwollfadenbruchstücke festgestellt werden, wie sie zwangsläufig beim Zerreißen von Stoff wie dem Bettlaken entstehen«. Nach einem Besuch ihres Vaters zu ihrem 33. Geburtstag hatte Ingrid zuletzt noch am 10.11.1977 mit einem Rechtsanwalt gesprochen, über einen Antrag auf Verlegung nach Frankfurt-Preungesheim. Dabei hatte sie einen »zunehmend aufgeschlossenen« Eindruck hinterlassen. Ihre Angehörigen können sich bis heute nicht vorstellen, daß sie sich aus Resignation oder Verzweiflung umgebracht hätte.
- Ulrike Meinhof war schon am 9.5.1976 unter ähnlichen Umständen in ihrer Zelle aufgefunden worden. Sie hing mit dem Kopf in einer Schlinge, die so weit war, daß sie nur nicht herausgefallen ist, weil sie mit ihrer linken Ferse fest auf einem Stuhl abgestützt war. Einem Stuhl, der auch nur durch die Leichenstarre im Gleichgewicht gehalten wurde, weil er mit einer unterliegenden Matratze und Wolldecken erhöht worden war. Das Stuhlarrangement sowie der in einem normalen Winkel aufgesetzte Fuß widersprechen den primitivsten kriminaltechnischen Kriterien für einen Sprung in den Selbstmord. Die typischen Merkmale für einen Strangulationstod durch Erhängen, wie die Verschiebung von Halswirbeln oder, beim Fehlen eines Genickbruchs, Blutungen in den Augenbindehäuten, konnten auch nicht entdeckt werden. Dagegen gab es Quetschungen und Blutergüsse an den Beinen und Hüften, die nicht vom Stuhl herrühren konnten. Die Internationale Untersuchungskommission, die sämtliche Unterlagen zu Ulrikes Tod untersucht hat, legte den Schluß nahe, daß sie tot war, als sie aufgehängt wurde, und daß die Indizien eher auf Erwürgen oder Erdrosseln hätten schließen lassen müssen.4 Der Strick, mit dem Ulrike sich am Zellenfenster erhängt haben soll, bestand aus einem Handtuchstreifen von etwa vier Zentimeter Breite. Spätere Versuche ergaben, daß ein Strick aus diesem Material und in dieser Breite bei jeder plötzlichen Belastung sofort hätte reißen müssen. Im Bericht der gerichtsmedizinischen Untersuchung war dieser Streifen 68 Zentimeter lang, mit einem zusätzlichen Doppelknoten unter dem Kinn – zu lang für eine glaubwürdige Erhängung. In der darauffolgenden Obduktion wurde die Länge des Streifens dann kurzerhand auf 51 Zentimeter festgeschrieben. Weiter wurde dem Obduzenten Professor Rauschke vom damaligen Generalbundesanwalt Buback ein Aussageverbot gegenüber dem von der Familie bestellten Nachobduzenten erteilt.
- Dazu ist zu wissen, daß Rauschke, der sämtliche gerichtsmedizinischen Untersuchungen in Stammheim geleitet hat, nach meiner Einschätzung immer dann herangezogen wurde, wenn es etwas zu vertuschen gab. Im Mai 1975 »übersah« er bei Siegfried Hausner die schweren Schädelverletzungen durch Kolbenhiebe, die zu dessen Tod geführt hatten. Im Oktober 1979 tauchte er beim Diktator Mobutu in Zaire auf, wo er sich offensichtlich mit der Obduktion von sieben Leichen beim Verschleiern eines OTRAG-Raketenunfalls nützlich gemacht hat.5
- Weder von Ulrike Meinhof noch von Ingrid Schubert wurden Hautproben für einen Histamintest genommen, mit dem hätte festgestellt werden können, ob die Aufhängung vor oder nach dem Tod stattgefunden hat. Toxikologische Tests wurden nur auf wenige Stoffe beschränkt, wie eines der Gutachten feststellte: »Mit den angewandten Methoden werden folgende Substanzgruppen nicht erfaßt: anorganische Verbindungen, tierische und pflanzliche Giftstoffe, die meisten Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie viele als Pharmaka nicht verwendete organische Verbindungen.«
- Wenn es in all dem »keinerlei Anhaltspunkte« für Fremdeinwirkung gegeben haben soll, so frage ich, was da für Selbstmord spricht.
- »Nicht Tod, sondern Leben«
- Wichtiger ist mir aber, daß wir Selbstmord als Entscheidung oder Mittel in unserem Kampf immer abgelehnt haben. Eine »Diskussion über Selbstmord« hat es in der Gruppe nicht gegeben, weil bei uns Politik und persönliche Identität in eins gesetzt waren, bestimmt an den politischen Zielen, in der Gefangenschaft wie in der Illegalität. Im Knast ist das nur noch schärfer: Da läßt du dich nicht so einfach kleinkriegen, machst es dem Apparat so schwer wie nur möglich. Aufstehen, weiterkämpfen, leben, Widerstand – die »Waffe Mensch«. Oder wie Gudrun schrieb: »Wir können gar nicht damit aufhören, die Verhältnisse vom Kopf auf die Füße zu stellen, haben erst angefangen. Nicht Tod, sondern Leben.«6
- Von Seiten des Staates wurde seit den Anfängen der RAF kein Geheimnis daraus gemacht, daß die Bande aufgerollt und ihre Schlüsselfiguren ausgeschaltet werden müßten.7 Da sollten ausgerechnet die, die für uns am meisten Orientierung waren, sich selbst umgebracht, die Gruppe ohne Kader gelassen, den Bullen die Arbeit abgenommen haben? Die Konstruktionen und Interpretationen, die es dazu inzwischen gibt, lassen sich überhaupt in keine einzige politische Bestimmung einpassen. Leute wie Ulrike und Andreas hätten es dem Staatsschutz nie so leicht gemacht, sich selbst aus dem Weg zu räumen. Ich kann mir Selbstmord auch nur als eine individuelle Entscheidung vorstellen, nicht mehr weiter zu können, als Aufgeben, als das Ende des Willens und der Politik. Ich habe es in den schlimmsten Momenten nicht versucht, nicht mal in Erwägung gezogen. Egal, ob das eine als Mord inszenierte Strategie sein soll, ein Akt der »Befreiung« oder eine Sache der Verzweiflung, es wäre ein Zugeständnis gewesen, daß alles aus sei.
- Dazu gab es aber keinen Grund. Abgesehen von der militärischen Niederlage in den festgefahrenen Geiselnahmen, hat die Situation 1977 politisch noch für die RAF gewirkt. Alles sprach damals für Kontinuität. Die Gefangenen waren intensiv beschäftigt mit den Verfahren, mit den Texten, die veröffentlicht werden sollten, und mit internationalen Diskussionszusammenhängen, in denen sie auch ein Stück Verantwortung hatten. Egal welche Perspektive eingenommen wurde – rauszukommen oder nicht – unser Kampf ging einfach weiter. Jeder und jede hatte dazu auch Lust. Wir sahen uns in einem Prozeß, in dem der Kampf in der Gefangenschaft eine sich noch potenzierende Wirkung erzeugt hatte – eine Wirkung, die kurz- oder langfristig durch einen Selbstmord nur in Desorientierung gekippt wäre.
- Die Vehemenz, mit der vom Staatsschutz bis zur Bundesregierung jedem Zweifel am Selbstmord der Gefangenen begegnet worden ist, hat vielen zu denken gegeben. Deshalb wurden eiligst die abenteuerlichsten Konstruktionen verbreitet, die die Herkunft der Waffen nachträglich glaubhaft machen sollten: Sprengstoff in der Unterhose, Waffen in Gerichtsakten durch die peniblen Kontrollen des Wachpersonals geschleust. Verstecke in zehn verschiedenen Zellen mit Schraubenziehern in massivem Beton der Güteklasse »B600« ausgehöhlt. Eine Waffe in einem mehrmals vorenthaltenen und kontrollierten Plattenspieler, von der einen Zellenverlegung zur anderen gewandert. Ein phantastisches Kommunikationssystem aus Leitungen, Lötstellen, Lautsprechern, Mikrofonen und Radios …
- Entsprechend dürftig ist die Beweisführung, für die der »Kronzeuge« Volker Speitel und sein Gefolge aufgeführt wurden, um Waffentransporte in den Stammheimer Trakt plausibel zu machen. Speitel, der bei seiner Verhaftung nach eigenen Angaben »wahnsinnige Angst« hatte, wurde mit Maßnahmen des Jugendamts gegen seinen achtjährigen Sohn unter Druck gesetzt. Seit den ersten Zeugenvernehmungen gegen uns (Ruhland, Brockmann, Müller) wissen wir, wie Belastungszeugen mit Formulierungen vom Staatsschutz gefüttert wurden, Passagen auswendig zu lernen. In den wenigen Prozessen, in denen sie auftauchen mußten, wurden ihre Aussagegenehmigungen eingeschränkt. Sobald sie vom vorgestanzten Schema abwichen (wie Peter-Jürgen Boock, der davon lebt), widersprachen sie sich gegenseitig und verhedderten sich in Interpretationen »vom Hören-Sagen«.
- Ich habe sie sechs Monate lang erlebt, die Leibesvisitationen, Rollkommandos und Zellenverlegungen in Stammheim. Im Prozeß gegen die Rechtsanwälte Arndt Müller und Armin Newerla, die des teilweise »unwissentlichen« Waffentransports beschuldigt wurden, hat es Aussagen von mehr als dreißig Beamten gegeben, die diese Transporte in Zweifel zogen. Und alle, die Irmgard Möller länger kennen, wissen, daß sie nicht lügt. Ihre Erklärungen sind seit 30 Jahren in sich konsistent. Da gibt es keine Widersprüche.
- Kein Frieden mit den Verhältnissen
- Über den wahren Verlauf der Stammheimer Todesnacht wissen wir bis jetzt nichts. Aus Berichten der RAND-Corporation (einem neokonservativen Thinktank aus den USA) und der CIA ist bekannt, daß die RAF 1977 als eine der drei gefährlichsten Gruppen eingeschätzt wurde, und daß die Nachrichtendienste sich darin einig waren, das Problem der Guerilla mit der Liquidierung ihrer »Symbolfiguren« lösen zu können. Beamte des BND hatten freien Zugang zum Stammheimer Trakt. Es gab einen direkten Zugang von außen in den Trakt über ein abgesondertes, abgeschirmtes Treppenhaus. Einiges, was wir uns so vorstellen können, trägt die Handschrift des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, dessen Abteilungschef Gideon Mahanaimi 1986 zugab, »befreundeten Diensten« mit dem »Töten von Terroristenchefs« behilflich gewesen zu sein. Es ist auch bekannt, daß der BND dem Mossad in verschiedenen deutschen Gefängnissen Zugang zu palästinensischen Gefangenen verschafft hat, daß vom Mossad in Afrika und Lateinamerika ausgebildete Aufklärungsexperten Gefangene umgebracht haben und daß der Mossad als der kleinste Nachrichtendienst vergleichsweise die wenigsten Verratsfälle verzeichnet.8
- Natürlich wissen wir nicht, wie die »Amtshilfe« genau ausgesehen hat, wer im Apparat tatsächlich davon gewußt oder wer davon nur Vermutungen gehabt hat. Der Countdown zur Todesnacht konnte genau verfolgt werden, als die psychologische Kriegführung gegen die Stammheimer Gefangenen hochgezogen wurde – nach den ersten Befreiungsversuchen in Stockholm 1975 und in Entebbe 1976. Aktionen der RAF würden »aus den Zellen gesteuert«, die RAF hätte Angriffe auf Kernkraftwerke und Kinderspielplätze geplant, der »Spuk« sei nur »mit neuen Mitteln« zu beseitigen. Gesetzliche und ungesetzliche Maßnahmen steigerten sich in der Eskalation der letzten drei Monate: ein als Provokation veranstalteter Überfall auf die Gefangenengruppe in Stammheim, die Beschlagnahme der Klageschrift an die Europäische Menschenrechtskommission, die Verhaftung der Rechtsanwälte und Komiteemitarbeiter, ein Bombenanschlag auf die Stuttgarter Anwaltskanzlei. Bei jedem Geschehen draußen wurden die Gefangenen wie Geiseln mit dem Entzug von Kontakten und Nachrichten bestraft, bis zur Zuspitzung in der »Kontaktsperre«, die ihnen den letzten Rest von Schutz entzog. Bekanntlich hat in der Todesnacht nicht einmal die Videoanlage im Flur des Stammheimer Hochsicherheitstrakts funktioniert.
- Vor dreißig Jahren schrieb der Pflasterstrand noch unverhüllt: »Wir schrecken zurück vor der Mordthese, die – wie auch immer im Detail– eine verdammt ernste Konsequenz hätte.« und weiter: »Mord: das hieße, daß es in der BRD zumindest gegenüber bestimmten Gruppen offenen Faschismus gibt und das heißt, daß wir endgültig und absolut nicht so weiterleben können wie bisher.«9 Heute wird kaum noch etwas hinterfragt, wenn staatstragende »Sperrmüllproduzenten« (wie Peter Chotjewitz sie nennt) oder welche aus unseren früheren Zusammenhängen sich mit dem Kronzeugengelaber um »gesellschaftliche Anerkennung« bemühen. Für sie ist »Mord oder Selbstmord« tatsächlich zur »Glaubensfrage« geworden, weil ihr Bezug zur Geschichte der Frieden mit den bestehenden Verhältnissen geworden ist. Den Widerspruch zum Selbstmord versuchen sie noch mal mit dem wahnwitzigen Konstrukt einer behördlichen Komplizenschaft zu lösen – beim Selbstmord, versteht sich. Im großen Konzert sollen damit wieder rechtzeitig zum soundsovielsten Jahrestag gleich aus allem, was von den Gefangenen bekannt ist, »linke Legenden« gemacht werden, aus Lügen »Reue«, und aus denen, die weiterhin zu ihrer Geschichte stehen, »Hardliner«.
- Anscheinend sollen damit auch die Stammheimer Gefangenen ein zweites Mal umgebracht werden, denn der »zweite Tod« im biblischen Sinne ist ja die endgültige Abweisung der Verdammten in die Hölle, weil sie sich geweigert haben, Reue zu zeigen. Für Dante war er der ehrenwerteste.
- Fakt bleibt, daß das letzte Wort zu unserer Geschichte noch nicht gesprochen ist. Auch wenn so manche das nicht wahrhaben wollen.
Fußnoten
- 1 Karl-Heinz Weidenhammer, Selbstmord oder Mord? Todesermittlungsverfahren Baader, Ensslin Raspe, Neuer Malik Verlag, Kiel 1988
- 2 Kriminaloberkommissar Günter Textor in der Frankfurter Rundschau, 27.10.1977 und 14.12.1977
- 3 Vgl. Oliver Tolmein, »RAF – Das war für uns Befreiung«; Ein Gespräch mit Irmgard Möller über bewaffneten Kampf, Knast und die Linke, Konkret Literatur Verlag, Hamburg 2002
- 4 Vgl. Bericht der Internationalen Untersuchungskommission. Der Tod Ulrike Meinhofs, Reprint, Unrast Verlag, Münster 2007
- 5 Informationsdienst zur Verbreitung von unterbliebenen Nachrichten, 7.11.1979. Die deutsche Firma Orbitaltransport und Raketen AG erprobte Raketenantriebssysteme
- 6 Eine Sammlung aller RAF-Dokumente befindet sich im Internationalen Institut für Soziale Geschichte in Amsterdam. Die Sammlung wird demnächst auch digital zur Verfügung stehen. Die Website befindet sich derzeit in Bearbeitung: labourhistory.net/raf
- 7 Vgl. Reinhard Rauball, Die Baader-Meinhof Gruppe, Verlag Walter De Gruyter, Berlin 1973
- 8 Vgl. Le Soir, 13.1.1986, und Der Spiegel, 29.10.1979
- 9 Pflasterstrand, Dezember 1977