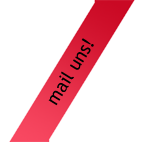Aus Der Standard vom 6./7.10.2012:
Kommentar der anderen |
Richard Schuberth, 5. Oktober 2012
Wider die sozialtechnokratische Gleichmacherei in der Debatte um die Zukunft des Pensionssystems: Die EU will das Rentenalter proportional zur durchschnittlichen Lebenserwartung anheben – verschweigt aber, wessen Lebenserwartung
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Welche wollen Sie zuerst hören? – Die gute, Herr Sozialkommissar. – Ihre statistische Lebenserwartung ist in den letzten Jahren um sechs Prozent gestiegen. Die schlechte: Sie werden wohl einsehen, dass Sie sich in Anbetracht dieser wissenschaftlichen Erkenntnis nicht schon mit 65 auf die faule, faltige Haut legen und um sechs Jahre länger Pension beziehen können. – Was aber, Herr Sozialkommissar, wenn mein renitenter Körper die Statistik nicht befolgen will und schon mit 66 stirbt?
In Zeiten der Krise müssen alle Opfer bringen. Selbstverständlich werden diese Opfer sozial gestaffelt, und zwar nach bewährter Methode: entgegen der sozialen Bedürftigkeit. Wer mehr hat, bringt weniger Opfer, und umgekehrt, wer probates Opfer ist, muss noch mehr Opfer bringen, und sei es sich selbst. Da diese Logik der Grausamkeit kaum auf Widerstand stößt, wird sie fröhlich forciert.
Die EU leistet sich einen sogenannten Sozialkommissar, László Andor heißt der amtierende. Wer sich von solch einem Posten die Eindämmung der Verelendung weiter Bevölkerungsteile und die Umleitung von Kapitalsteuerflüssen in sozialstaatliche Maßnahmen erwartet, ist schief gewickelt. László Andor ist mehr Kommissar als sozial, er fordert die schleunige Anhebung des Pensionsantrittsalters in Anbetracht der statistischen Gewissheit, dass „die Wahrscheinlichkeit der heute arbeitenden Generation und ihrer Kinder, das 100. Lebensjahr zu erreichen, stetig steigt“ (STANDARD, 20. 9. 2012).
Verdinglichte Vernunft
Seine soziale Kompetenz hatte er in seiner Heimat Ungarn bewiesen, indem er dem sozialdemokratischen Premier Ferenc Gyurcsány das Händchen dabei führte, ungarische Gürtel enger zu schnallen, was deren Träger prompt dazu bewog, Viktor Orbáns Fidesz-Partei zu wählen, welche dieses Geschäft wenigstens mit nationalem Wahn kompensiert. Maß für die statistisch erwiesene Verlängerung der Arbeitsfähigkeit nimmt Andor an seinem einstigen beruflichen Umfeld in Ungarn: „Das Pensionsalter für Hochschullehrer liegt dort bei 70 Jahren, und das ist sehr in Ordnung für mich.“ Und was sehr in Ordnung für den 46-jährigen Ökonomen ist, soll bald eherne Ordnung werden für Millionen europäischer Greise sein. Vielen von ihnen wurde schon in Andors Alter nahegelegt, dass sie nicht vermittelbar seien. Aufgerieben zwischen diesem Double-Bind gehen dem statistisch verlängerten Leben nun wenigstens die Sorgen nicht aus. Aber wird es wirklich länger dauern?
Selten war sich verdinglichte Vernunft einiger, quer durch alle politischen Lager. Arbeitnehmervertreter feilschen gelegentlich zwar noch um ein paar Lebensjahre, doch auch sie wollen nicht als bildungsferne Bremser dastehen und fügen sich mit dem verantwortungsvollen Nicken des Citoyens in die Notwendigkeit, die rüstigen Siebzigjährigen ihre Pensionen nicht in Tanzbars und beim Bungee-Jumping verprassen zu lassen.
Die Rechnung hat bloß einen Haken: Wissenschaft sträubt sich hie und da noch, Erfüllungsgehilfin herrschender Interessen zu sein. Und hier darf die Polemik einen Schritt zurücktreten und – um die halbe Wahrheit zu einer ganzen zu komplementieren – anderen Statistiken das Wort erteilen:
Seit Jahrzehnten existieren nämlich Studien zur Lebenserwartung, die Gesellschaft nicht als egalitäre Familie von Bürgern begreifen, die an einem Strang ziehen, sondern soziale Differenz als Parameter miteinbeziehen. Sie alle kommen zum selben Ergebnis: Der hoffnungsvolle Durchschnittswert erhöhter Lebenserwartung wird von den reichen Segmenten der Gesellschaft verzerrt. Älter werden nämlich nur die Wohlhabenden, die weniger Wohlhabenden leben gleich lang wie ihre Eltern, und die Unwohlhabenden sterben sogar früher.
Einige Beispiele: Das Economic Policy Institute in Washington präsentierte 2006 eine Studie, derzufolge die durchschnittliche Lebenserwartung der reicheren Hälfte der US-amerikanischen Bevölkerung seit 1986 um sechs Prozent, die der ärmeren bloß um ein Prozent zugenommen habe.
Österreich teilt sich mit Deutschland zwar die Pflichtbeflissenheit bei der Sozialstaatsdemontage, nicht jedoch die Tradition kritischer Soziologie. Folglich existieren hierzulande keine Daten zum Social Gap der Lebenserwartung. Die österreichische Situation dürfte aber in etwa der deutschen entsprechen.
In Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kürzlich eine Studie aktualisiert und methodisch verbessert, die schon vor zehn Jahren zu ähnlichen Resultaten gekommen war: „Männer aus armutsgefährdeten Haushalten und solchen mit prekären Einkommen leben (…) durchschnittlich fünf Jahre weniger als Männer aus wohlhabenden Haushalten.“ Bei Frauen falle der Unterschied geringer aus.
Wetten, dass …?
Und die Deutsche Rentenversicherung gab im Vorjahr eine Studie in Auftrag, die sie mit der Erkenntnis belohnte, dass die statistische Lebenserwartung von Geringverdienern in zehn Jahren um zwei Jahre abgenommen habe. Drei Streiflichter bloß in eine Unzahl europäischer und amerikanischer Untersuchungen, deren Ergebnisse nur geringfügig voneinander abweichen.
Die Ursachen, warum Niedrigverdiener es vorziehen, das Pensionssystem früher zu entlasten als Reiche, sind nicht schwer zu erraten, obwohl der eine oder andere Poster wieder einmal wissen wird, dass Konsumenten mit Stil und Kaufkraft eben lieber Prosciutto als Klebeschinken essen und lieber nordisch walken als südlich sandeln.
Wie dem auch sei, die Conclusio aus all diesen Studien mag derart polemisch und tendenziös klingen, dass man sie sich fast nicht aussprechen traut; doch biete ich meine ganze Altersrente (die ich der Statistik zufolge etwa zwei Jahre in Anspruch werde nehmen dürfen) jedem, der mir das Gegenteil beweist: Die früher sterben, sollen länger arbeiten, damit die, die länger leben, länger ihre hohen Renten und Privatvermögen genießen dürfen. Ansonsten, sagt der Sachzwang, sei das Pensionssystem nicht mehr zu retten.
Wie verriet mir einmal ein Halsabschneider, der arme Schlucker durch die Hoffnung auf hohe Geldgewinne in ein Dorfwirtshaus gelockt hatte, um ihnen Stabmixer und Föhnhauben anzudrehen? „Wer sich verarschen lässt, ist selber schuld.“ Wie wahr. Doch um diese Schuld zu tilgen, ist es nicht zu spät. Die Feuilletonisten greinen neuerdings über die Inhumanität des Wirtschaftssystems und gefallen sich als späte Konvertiten zur Kapitalismuskritik. Dies schafft die beruhigende und darum gefährliche Illusion einer allgemeinen Bewusstseinsumkehr, hinter der das neoliberale Regime noch brutaler seine Geschäfte zu Ende bringt.
Doch die Privatisierung der Gewinne und Sozialisierung der Schulden ist kein unumkehrbares Naturgesetz. Und wer die Grausamkeit und Dummheit dieser Ordnung, die für László Andor „sehr in Ordnung“ ist, durchschaut, dem wird etwa das reformistische Betteln darum, doch schon mit 77 und nicht erst mit 83 in Pension gehen zu dürfen, wie Pickelausdrücken auf einem Karzinom vorkommen. Man wird es großräumig rausschneiden müssen. Das könnte die Lebenserwartung aller heben. (Richard Schuberth, DER STANDARD, 6./7.10.2012)
Richard Schuberth, geb. 1968, lebt als freier Publizist und Bühnenautor in Wien. Seine Tragikomödie „Wie Branka sich nach oben putzte“ ist soeben bei Drava als Buch erschienen.