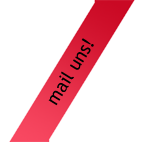Da ist sie wieder, die Binnen-I-Debatte. Sommerlich leicht in den Argumenten („stört den Lesefluss“, „ist umständlich“, „zerstört die deutsche Sprache“) werden die zugrunde liegenden Prinzipien geschlechtersensibler Sprache geflissentlich ausgeblendet. Beachtlich ist die Liste der Unterstützenden des Krone-Briefes, der aktuell von Blatt zu Blatt wandert. Personen aus Bildungseinrichtungen mit Rang und Namen (Konrad Paul Liessmann, Heinz Mayer) sind vertreten – und haben offensichtlich auch kein Problem damit, mit rechten Kreisen zu paktieren (siehe http://fm4.orf.at/stories/1742481/). Der Tenor ist simpel wie Gabalier: zurück zur „Normalität“. Platz gibt’s dafür selbstverständlich im gesamten Qualitäts- wie Boulevardarrangement der sommerlichen Löcher.
Von so viel Medienaufmerksamkeit träumen frauenpolitische NGOs, wenn es um ernste Themen wie Sparpolitiken (Doku Graz, Frauengesundheitszentrum Graz), um Besetzungsfragen (ORF Stiftungsrat, EU-Parlament) oder um strukturelle Gewalt (in der Arbeit, im sozialpolitischen Kontext) geht. Doch Medienlogik funktioniert – leider größtenteils auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk – anders.
Reaktionäre Stellungnahmen – und kommen sie auch noch so absurd daher – finden in den Medien stets Gehör, insbesondere, wenn es sich um (anti-)feministische Debatten handelt. Dabei schien das alpenländisch-konservative Österreich noch vor wenigen Wochen überholt zu sein. Es funkelte der bombastische Regenbogen des Phönixes in allen Farben. Conchita Wurst am Ballhausplatz. Medientaumel, Promidichte. Der merkwürdig selbstgefällige mediale Rausch – sich als gendersensibles queeres Österreich abzufeiern – bremste sich jedoch mit dem Skandal rund um das Life-Ball Plakat („Ich bin Adam. Ich bin Eva. Ich bin ich“) abrupt ein. Kalkuliertes Medienecho, die üblichen ProtagonistInnen als Debattengarnierung folgten. Heterosexuelle geben vor, für ihren Lebensstil diskriminiert zu werden. Das Staunen darüber bleibt ungedruckt.
Und nun, begleitet vom Nach-WM-Fernsehdepressionsschub, kommt die Sprachdebatte im vollen Rückwärtsgang daher. Dazwischen performte noch ein Schlagersänger die Bundeshymne für eine Getränkefirma und trat eine Diskussion um große Söhne los, die wir als politisch interessierte und engagierte Frauen gebraucht haben wie einen Kropf. Nicht, dass Sprache kein wichtiges Thema wäre – ganz im Gegenteil. Die Frauenbewegung(en) haben sich das sprachliche Sichtbarwerden hart erkämpft, die (feministische) Sprachwissenschaft liefert seit Jahrzehnten wichtige Ergebnisse, die nach wie vor darauf warten, von den Massenmedien unters Volk gebracht zu werden.
Was bekannt sein dürfte, ist, dass Sprache sich immer verändert. Ihr ständiger Wandel schließt die zeithistorischen Debatten und Kämpfe um Sichtbarkeit ein. Wer wird genannt? Wer bleibt mitgemeint? Wer bleibt ausgeklammert? Die Debatte ist alt. Alle Argumente für eine geschlechtersensible Sprache sind seit den 1970er-Jahren bekannt – zumal sie Feministinnen und Frauenpolitikerinnen seit Jahrzehnten gebetsmühlenartig wiederholen müssen.
Sie alle – und damit auch die Plattform 20000frauen – befinden sich in einem merkwürdigen Debatten-Dilemma: Bleiben sie an altbekannten Themen dran, etwa den Lohnunterschieden und der unbezahlten Haus- und Pflegearbeit, ernten sie im besten Fall journalistisches Gähnen, wenn nicht glatt das Gegenteil behauptet wird („Mythos Lohnschere“). Gehen sie auf die Gewaltfragen in der Gesellschaft, in den Familien und den sozialen Strukturen ein, so werden Einzelfälle vermarktet, Storys verdichtet, Klischees und Geschlechterarrangements vernutzt.
Auch Aktivistinnen der Plattform 20000frauen wurden und werden immer wieder mal um Interviews gebeten. Meist handelt es sich dabei um Themen, die stromlinienförmige Profil-Journalisten und kernige Kronenzeitungs-LeserbriefschreiberInnen vorgeben oder die in die Kategorie „Lifestyle“ eingeordnet werden. Aber der Lohn lässt meist nicht lange auf sich warten: Wenn wir uns danach vorwerfen lassen dürfen, wir hätten „keine anderen Sorgen“. Daher ein praktikabler und überaus Platz sparender Vorschlag zur aktuellen Debatte: ab nun das generische Femininum für die kommenden 100 Jahre einzusetzen (Männer sind natürlich mit gemeint), damit wir uns vermehrt den Themen widmen können, um die es uns geht: um Arbeitsbewertung, selbstbestimmtes Leben und Gewaltfreiheit.